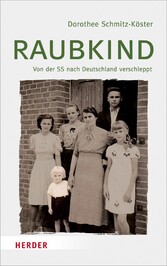Suche
Lesesoftware
Specials
Info / Kontakt
Raubkind - Von der SS nach Deutschland verschleppt
von: Dorothee Schmitz-Köster
Verlag Herder GmbH, 2018
ISBN: 9783451813061 , 240 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 16,99 EUR
eBook anfordern 
Aufgestört, beunruhigt, neugierig
Er wälzt sich auf die Seite, zieht die Beine an, macht sich wieder lang – nein, so wird das nichts. Also auf die andere Seite. Sofort spürt er sein Herz. Wieder auf den Rücken. Der Wecker tickt. Dreißig Jahre ist das Ding bestimmt schon alt. Und funktioniert immer noch. Sonja schnarcht leise. Eigentlich stört es ihn. Aber er hat sich daran gewöhnt. Wie er sich immer an alles gewöhnt hat, von klein auf.
Er kann einfach nicht einschlafen. Die Gedanken rasen durch seinen Kopf, springen hin und her, nichts lässt sich fassen und zu Ende führen, alles geht durcheinander. Und »Stopp« kann er auch nicht sagen.
Er muss einfach immer daran denken. Wenn er das Gras mäht, wenn er zum Einkaufen fährt, wenn er seine fünfhundert Meter schwimmt. Und wenn er mit Sonja zusammen ist sowieso. Dann reden sie darüber, immer und immer wieder. Bis Sonja meint: Lass uns doch mal über was anderes reden. Also reden sie über was anderes – aber für ihn ist es immer da, auch wenn er versucht, es beiseite zu schieben.
Kannst du wieder nicht schlafen, Klaus?, fragt Sonja plötzlich. Soll ich dir eine Tablette holen?
Nein, nein. Er wehrt ab. Entschuldigt sich, weil er sie geweckt hat. Liegt still, obwohl ihm das schwerfällt.
Als neulich dieser Brief im Kasten lag, wusste er sofort: Da kommt etwas auf ihn zu. Das wird ihn nicht mehr loslassen. Und wie auf Kommando hatte sein Herz angefangen zu holpern.
Dabei hatte die Journalistin nur geschrieben, sie sei durch ein Buch auf ihn aufmerksam geworden. Ein Buch über die SS-Familie Schäfer, das Ingeburg Schäfer verfasst habe, die älteste Tochter. »Mutter mochte Himmler nie« – er kenne das Buch sicher. Er sei doch 1944 als Pflegekind zu dieser Familie gekommen, aus dem Lebensborn-Heim in Bad Polzin. Ob er sich an dieses Heim erinnern könne? Ob er wisse, warum er dort gewesen sei? Darüber würde sie gerne mit ihm reden. Sie beschäftige sich nämlich mit dem Lebensborn, auch mit dem Heim in Bad Polzin …
Das will ich nicht!, war sein erster Gedanke gewesen. Ich weiß darüber gar nichts. Und ich will auch nicht darüber reden.
Jetzt muss er sich doch wieder umdrehen.
Fünfundsiebzig Jahre hat er jetzt gelebt, ohne etwas über die Zeit zu wissen, bevor er zu den Schäfers gekommen ist. Und schlecht waren diese Jahre nicht. Wirklich nicht. Aber so einfach lässt sich das Thema nicht beiseiteschieben.
Nein, Sonja ist nicht schuld. Sie hat natürlich nach dem Brief gefragt und ihn natürlich auch gelesen. Seitdem reden sie darüber. Nein – jetzt liegt er wieder auf dem Rücken –, er ist selbst schuld. Weil er sich immer wieder vorstellt, er würde sich auf die Journalistin einlassen. Er würde ihr seine Geschichte erzählen … Vielleicht könnte sie herausfinden, was damals passiert ist. Vor fünfundsiebzig Jahren. Mit ihm. Mit seinen richtigen Eltern, Friedrich und Maria B.
Die Schäfers haben ihm immer gesagt, die beiden seien tot, der Vater gefallen, die Mutter kurz nach der Geburt gestorben. Deshalb hätten sie ihn als Pflegekind in ihre Familie aufgenommen. Deshalb hätte er auch einen anderen Nachnamen. Er hat das geglaubt. Lange. Aber irgendwann fing er an zu zweifeln …
Jetzt ist er so wach, dass er aufstehen muss. Am liebsten würde er sich jetzt an eine Werkbank stellen und hobeln. Die gleichmäßige Bewegung täte gut. Oder mit einem Hund durch die Straßen laufen – wenn sie einen Hund hätten. Er wird uns überleben, sagt Sonja immer. Außerdem macht er Dreck. Sie hat sowieso schon genug Arbeit mit der Wohnung.
Im Flur schaut er kurz in den Werkzeugschrank. Streicht zärtlich über die schönen Hobel, die ihm ein alter Schreiner überlassen hat. Die Griffe glänzen, so glatt ist das Holz. Ja, er hat immer gerne gearbeitet. War ein guter Beruf. Und praktisch. Die Anbauwand, den Couchtisch, den Musikschrank – alles hat er selbst gebaut.
Er legt sich aufs Sofa, schaltet den Fernseher ein, schaut hin, ohne etwas zu sehen. Wer ist überhaupt diese Journalistin? Ob sie seine Geschichte ausschlachten will? Es gehe ihr um den Lebensborn, hat sie gestern am Telefon gesagt. Und was in den Heimen der SS-Organisation wirklich passiert ist. Mit den Müttern und vor allem mit den Kindern. Er ist also nur einer von vielen, mit denen sie redet. Das hat ihm gefallen. Da konnte er ihr nicht einfach absagen, sondern hat um Bedenkzeit gebeten. Jetzt macht sie sich natürlich Hoffnungen.
Wie kommt sie eigentlich darauf, dass er etwas mit dem Lebensborn zu tun hat? In Inges Buch ist davon nicht die Rede. Oder doch? Er steht auf und holt sich das Buch, das die Stiefschwester über ihre Familie geschrieben hat. Wie immer schaut er sich zuerst die Fotos im Mittelteil an. Das letzte Bild zeigt ihn mit den vier Schäfer-Kindern und der Stiefmutter. Damals war er acht oder neun und lebte schon ein paar Jahre bei ihnen. Er blättert nach vorn, wo ein Zettel steckt. Die Stelle, die ihn betrifft, ist rot angestrichen. Sie stammt aus einem Brief der Stiefmutter:
Ich war nämlich an diesem Tage nach Polzin gefahren, um mir aus dem Heim – nun setzt Euch erst einmal hin – unseren Pflegesohn Klaus zu holen. Er ist elternlos, im gleichen Alter wie Volker, kommt also mit ihm zusammen zur Schule, sieht nett aus, blond und blauäugig, und hat sich schon gut bei uns eingelebt. Da er lange in Heimen war, ist die Lage seiner Kleidung katastrophal. So renne ich täglich alle Geschäfte nach diesem und jenem ab …1
Das hat die Stiefmutter ihren Eltern geschrieben. Im Frühjahr 1944, kurz nachdem sie ihn aus dem Heim geholt hat.
Und ausgerechnet diese Stelle ist der Journalistin aufgefallen. Obwohl die Stiefmutter das Wort Lebensborn in ihrem Brief gar nicht erwähnt. Allerdings hat sie auch kein Wort darüber verloren, dass nicht nur der Zustand seiner Kleidung katastrophal war, sondern seine ganze Verfassung. Das hat Inge im Buch ergänzt. Er habe offene Wunden an Händen und Füßen gehabt, eine Folge von »Frostschäden«, schreibt sie. Dazu »seelische Schäden« … Ja, ja, er war Bettnässer. Er konnte doch nichts dafür. Heimkinder sind häufig Bettnässer.
Woher Inge das eigentlich weiß? Hat sie mit der Stiefmutter darüber gesprochen? Als das Buch herauskam, war Eva Schäfer doch schon lange tot.
Warum hat Inge dieses Buch überhaupt geschrieben? Er weiß bis heute nicht, was sie damit erreichen wollte. Den Vater anklagen, weil er in der SS war? Oder umgekehrt – den Vater entschuldigen? Wen interessiert es denn heute noch, dass Johannes Schäfer ein Nazi mit Dreck am Stecken war?
Die Journalistin offenbar schon, sonst hätte sie Inges Buch ja nicht gelesen …
Inge! Inge wird der Journalistin erzählt haben, dass das Heim in Bad Polzin ein Lebensborn-Heim war. Er selbst hat das ja erst mit neunzehn erfahren, als er nach Süddeutschland gegangen ist. Lange her. Damals haben die Stiefeltern ihm einen Brief mitgegeben – zu einer Aussprache waren sie wohl zu feige. In dem Brief stand kurz und knapp, sie hätten ihn aus einem Lebensborn-Heim geholt. Das war alles. Kein Wort darüber, warum er in diesem Heim war und was Lebensborn bedeutet. Trotzdem war er so erschrocken, dass er den Brief sofort zerrissen und weggeworfen hat. Als hätte er nie existiert. Vergessen konnte er ihn allerdings nie.
Er rappelt sich hoch. Doch, eigentlich würde er gerne wissen, was damals geschehen ist, warum er im Heim war, in diesem Heim, und was mit seinen Eltern passiert ist. Vielleicht kann die Journalistin … Aber in die Zeitung will er nicht und ins Fernsehen erst recht nicht!
Er öffnet die Balkontür, atmet tief durch, macht ein paar Schritte nach draußen, schaut hinunter auf die Stadt. Wie immer hat er das Gefühl, als könnte er sich an die Hügel in seinem Rücken anlehnen. Die Luft ist mild. Es ist still, alle schlafen. Warum werden die Straßenlaternen nachts eigentlich nicht ausgeschaltet? Reine Verschwendung. Er holt sich eine Decke, wickelt sich ein, legt sich auf die Liege, schaut in den Himmel. Sind da Sterne? Dann schläft er ein.
Hoffentlich hast du dich nicht erkältet. Sonja guckt besorgt. Er ignoriert die Bemerkung, steht vom Frühstückstisch auf und holt sich Zettel und Stift. Sonja runzelt die Stirn. »Lebensborn-Heim«, schreibt er und trinkt einen Schluck vom dünnen Kaffee. Darunter setzt er »Bad Polzin« und »Entlassung nach Ostern 1944«. Schreibst du schon den Einkaufszettel?, fragt Sonja. Er reicht ihr das Blatt: Das ist das einzige, was ich sicher über die Zeit vor den Schäfers weiß. Ach, du bist schon wieder beim Thema, seufzt Sonja. Und was ist mit deinem Geburtsdatum und deinem Geburtsort? Sind die nicht sicher?
Doch, doch, nickt er. Das wird schon richtig sein. Obwohl er sich in den letzten Jahren immer wieder gefragt hat, ob die Informationen wirklich stimmen, die ihm die Stiefeltern mit auf den Weg gegeben haben. Warum hat er zum Beispiel keine Geburtsurkunde? Ein ordentliches Dokument mit Unterschrift und Stempel, mit Geburtsdatum und Geburtsort und mit den Namen seiner richtigen Eltern. Als junger Bursche hatte er nur einen Flüchtlingsausweis, das war alles. Und irgendwann war der Ausweis fort, verlegt, verloren, auf alle Fälle konnte er ihn nicht mehr finden.
Zum Glück hattest du nie Probleme ohne Geburtsurkunde, lacht Sonja. Bei unserer Hochzeit zum Beispiel. Und es kann doch sein, beschwichtigend legt sie ihre Hand auf seinen Arm, dass die Urkunde wirklich auf der Flucht verloren gegangen ist, wie Eva Schäfer gesagt hat. Er nickt. Dann fällt ihm ein, dass Inge und...