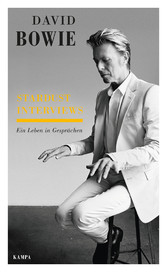Suche
Lesesoftware
Specials
Info / Kontakt
Stardust Interviews - Ein Leben in Gesprächen
von: David Bowie
Kampa Verlag, 2018
ISBN: 9783311700272 , 184 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 11,99 EUR
eBook anfordern 
Musik für den Dschungel
Im Gespräch mit David Thomas, 1983
Gehen wir zunächst ein paar Jahre zurück: Als Sie in mein Leben traten, war ich dreizehn Jahre alt – ich war genau dreizehn, als Ziggy rauskam …
Autsch! (Lacht.)
… und ich erinnere mich, dass ich ›Starman‹ bei Top of the Pops sah und dachte: Das ist was völlig Neues. Waren Sie sich der Wirkung bewusst, die das haben würde?
Ich fand es damals unheimlich aufregend. Die Band … na ja, die Band war eher verhalten, aber mir war vollkommen bewusst, wie außergewöhnlich die ganze Sache von außen ausgesehen haben muss. Ich war darüber glücklich, begeistert, weil ich dachte: Das ist jetzt wirklich absolut neu. Als ob »neu« das A und O wäre. Wenn man gerade mit Rock ’n’ Roll anfing, war es aber das, worum es einem ging.
Aber warum passierte das alles genau zu diesem Zeitpunkt? Sie hatten ›Space Oddity‹ draußen, aber abgesehen davon hatten Sie vorher jahrelang als David Jones Musik gemacht, und dann auf einmal – bum!
Ich glaube, ich war dabei, den ganzen Kontext der englischen Rockmusik zu verändern. Es fühlte sich unglaublich radikal an – gegen alles gerichtet, was zu der Zeit los war, mit den Jeans und dieser entspannten Atmosphäre. Das Härteste, was es gab, war Heavy Metal.
Es gab T. Rex …
Ja, es gab immerhin Marc und mich, die … Wir waren ja eine ganze Truppe. Ich hatte einfach das Glück, vor den anderen diese große Wirkung zu haben. Natürlich gab es Roxy Music und andere, und wir sind alle hier und da aufgetreten, nahmen uns gegenseitig wahr und wussten, dass wir alle ungefähr die gleiche Vorstellung davon hatten, wie wir wirken wollten, und es war gegen den Kunsthochschul-Rock gerichtet, vermute ich. Wir wollten halt alles, was irgendwie alt war, wegfegen, gegen alles sein, was vorher war.
Ironischerweise sprechen ausgerechnet Sie jetzt davon, dem Inhalt wieder mehr Platz vor dem Stil einzuräumen.
Ja.
Während man eigentlich auch Sie und Bryan Ferry für diesen kunstsinnigen Ansatz verantwortlich machen könnte …
(Lacht.) Nicht zum ersten Mal, wahrscheinlich! Ja, irgendwie ist das schon ein bisschen demoralisierend, dass das Neue, was ich mache, als kunstsinnig empfunden wird.
Vielleicht geht es ja nur darum, dass diese Veränderungen in dem Moment, in dem sie nachgeahmt werden, schon zur Pose werden.
Bei mir ist es einfach so, wenn ich eine Sache beendet habe, dann ist die Luft raus, und es macht mir keinen Spaß mehr. Selbst als Maler springe ich zwischen den Stilen hin und her, wechsle von Öl- zu Acrylfarben oder will auf einmal lieber kleine Miniaturen mit Wasserfarben malen. Ich habe nie eine Sache so lang verfolgt, dass sie zu meinem Lebenswerk hätte werden können. So eine Art Künstler bin ich nicht. Und das Gleiche gilt für Musik und Rock, wo mir auch immer gefallen hat, dass man sich als Künstler in allem Möglichen ausprobieren kann, in jedem Stil. Wenn man über das nötige Werkzeug verfügt, sind alle Kunstgattungen am Ende eins.
Sie sprachen bei der Pressekonferenz [am 17. März 1983 im Claridge’s Hotel in London anlässlich der Veröffentlichung von Let’s Dance] über den Druck, den Sie zu dieser Zeit empfanden, und dass Sie ein geringes Selbstwertgefühl hatten. Was meinten Sie damit?
Wenn ich ehrlich bin, war mein Selbstwertgefühl damals überhaupt nicht gering. Ich glaube, es war viel zu groß. Ich musste feststellen, dass ich mich in eine Situation gebracht hatte, in der alles, was ich gemacht oder gesagt habe, in Bezug auf mein eigenes Leben völlig folgenlos oder zusammenhanglos war. Und ich hatte es selbst verschuldet, weil ich mich völlig zurückgezogen hatte und in dieser Szene in Los Angeles aufgegangen war. Heute wundere ich mich nur noch über mich selbst, dass ich das damals zugelassen habe.
Ich habe Interviews mit Ihnen gelesen, in denen man den Eindruck bekommt, dass zwischen Ihrem Innenleben und dem, was Sie jeweils sagen, keinerlei Verbindung besteht.
Ja. Als Künstler habe ich Sachen aufgegriffen, die gerade in der Luft lagen, und habe sie aufgeschrieben. Und die habe ich dann – ziemlich stoned – groß gedeutet, was ein absoluter Fehler war, ein Künstler sollte seine eigene Arbeit nicht deuten. Und ich hatte dazu auch gar nicht die Möglichkeiten … Mein Denken war völlig fragmentiert.
Es gibt diese Bemerkung von Charles Shaar Murray, dass er sich fragt, was passieren würde, wenn man alle Charaktere von David Bowie abschälen würde – ob dann der echte David Bowie übrig bliebe.
Stimmt, ja, und das hat mich auch beschäftigt. Darum bin ich zurück nach Europa gezogen.
Es gibt eine Sache, die ich schon immer wissen wollte. Wenn Sie alte Fotos anschauen oder Albumcover, was denken Sie da, wenn Sie sich selbst sehen, zum Beispiel auf Pin Ups? Was denken Sie über den Typen, der Sie da anguckt?
(Lacht.) Ich denke: Mein Gott, wie kann man mit so einem Aussehen überleben?! Die ganze Geschichte hat optisch wahnsinnig Spaß gemacht. Eigentlich war es fast dadaistisch. Es war alles so irreal. Ich bin darauf ziemlich stolz, aber es ist auch endgültig vorbei, ich habe keine Verbindung mehr dazu. Ich kann den Enthusiasmus nicht mehr heraufbeschwören, den ich die ganze Zeit gehabt haben muss. Ich verstehe nicht einmal mehr genau, wieso ich so begeistert davon war. Eigentlich ganz lustig. Ich glaube, ich habe aus reinem Selbsterhaltungstrieb ein relativ sachliches und distanziertes Verhältnis dazu entwickelt.
Bei der Pressekonferenz fiel mir auf, dass Sie auf eine Frage nicht geantwortet haben, und zwar die nach Ihrer Tour 1976 und Ihrer Bemerkung, dass Großbritannien reif für einen Bürgerkrieg sei. Dann gab es noch Ihren Gruß mit ausgestrecktem Arm aus dem Mercedes Cabrio und so weiter. Wie stehen Sie, wenn Sie darauf zurückblicken oder wenn Sie an das berühmte Interview mit Michael Watts im Melody Maker denken, zu der Person, die das alles gesagt hat? Stimmen Sie dem in Teilen noch zu? Entsprach irgendwas davon damals wirklich Ihrer Überzeugung?
Ich hatte wohl so etwas wie eine Antenne. Oder nein, ich hatte auf jeden Fall eine Antenne. Ich glaube, ich habe sie immer noch, für die Ängste der Gegenwart oder den Zeitgeist. Zeitgeist trifft es am besten. Ich nehme die Atmosphäre um mich herum sehr genau wahr, egal wo ich bin. Und ich hatte ein Gespür für Dinge, die in der Luft lagen. Die ganze Nazi-Sache war nur ein Vorbote für das Erstarken der National Front in England, und ich habe es halt gespürt. Ich hatte gar keine Ahnung, was in England gerade los war, ich war seit Jahren nicht mehr dort gewesen. Ich habe es aber gespürt, und es passte einfach, weil ich – wie gesagt – so fragmentiert und kaputt war, es passte zu meinen eigenen Vorstellungen vom Britannien der Artuslegende, die mich damals unheimlich interessiert hat – all das, was das Englische der Engländer ausmachte und so weiter. Und es schien alles Sinn zu ergeben, zu der Zeit. Es ging dabei aber vor allem um Mythen, weniger um eine Umsetzung oder gar die Gründung von so was Grauenhaftem wie einer Nazi-Partei. Andererseits denke ich, wenn ich jetzt darauf zurückblicke: Wie unglaublich verantwortungslos! Aber ich war damals gar nicht in der Lage, mich verantwortungsbewusst zu verhalten. Ich war der verantwortungsloseste Mensch, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Haben Sie jemals eine Therapie gemacht oder sich in psychologische Behandlung begeben? Es scheint einen Punkt in Ihrem Leben gegeben zu haben, an dem Sie schließlich Verantwortung für sich übernommen haben. (Beim letzten Satz nickt DB zustimmend.)
Nein, ehrlich gesagt, habe ich Therapien immer unglaublich misstrauisch gegenübergestanden. Freunde haben mich zu der Entscheidung gedrängt, die USA zu verlassen. Die Tour 1976 habe ich im Grunde gar nicht mitbekommen. Ich erinnere mich an gar nichts.
Das waren sehr befremdliche Auftritte.
Ich habe einfach nichts gespürt. Ich war auf der Tour wie ein Zombie. Danach habe ich mich in Berlin versteckt, in der Wohnung, die ich da hatte.
Hatten Sie dort Freunde?
Ja, der wichtigste Mensch war meine persönliche Assistentin – Coco Schwab. Sie hat mich ein paar Mal richtig zusammengeschissen, also etwa so: »Mann! Komm mal zu dir!« (Lacht.) Es war wirklich so, und es hat funktioniert. Und ich bin auch zu mir gekommen, so gut ich konnte. Ich bin das sehr positiv angegangen, die Idee, mich zu erholen.
Hatten Sie nicht auf der Bühne einen Herzinfarkt?
Nein, nie. Eigentlich ein schönes Gerücht, aber es stimmt nicht. Irgendwie romantisch, aber ich habe ein sehr gesundes Herz!
»Die Tour 1976 habe ich im Grunde gar nicht mitbekommen. Ich erinnere mich an gar nichts.«
Zwischen Low und Heroes gab es dann eine Entwicklung – von der Negativität von Low zu dem Gefühl, dass es vielleicht doch so etwas wie Hoffnung, einen Sinn geben könnte.
Ja, und diese Entwicklung setzt sich...