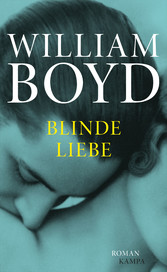Suche
Lesesoftware
Specials
Info / Kontakt
Blinde Liebe - Die Verzückung des Brodie Moncur
von: William Boyd
Kampa Verlag, 2019
ISBN: 9783311700395 , 512 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 10,99 EUR
eBook anfordern 
Teil I Edinburgh 1894
1
Brodie Moncur stand im Hauptfenster von Channon & Co. und blickte auf die dahineilenden Passanten, die Droschken, Kutschen und die sich abplagenden Brauereipferde draußen auf der George Street. Es regnete. Ein stetiger, sachter Regen, der hin und wieder von einer heftigen Windbö schräg gepeitscht wurde, und durch die Nässe wirkten die verrußten Fassaden der Gebäude gegenüber in dem trüben Licht fast schwarz. Wie Samt, dachte Brodie, oder Maulwurfsfell. Er nahm seine Brille ab und wischte die Gläser mit seinem Taschentuch sauber. Bei einem weiteren, brillenlosen Blick aus dem Fenster schien ihm das verregnete Edinburgh nun gänzlich von Wasser durchdrungen zu sein – die Gebäude gegenüber eine Klippe aus schwarzem Wildleder.
Er setzte die Brille wieder auf, hakte sich die Drahtbügel hinter die Ohren, und die Welt kehrte in den Normalzustand zurück. Er nahm seine Taschenuhr aus der Weste. Fast neun Uhr: Zeit anzufangen. Er klappte den glänzenden neuen Flügel auf dem Schaupodest auf und fixierte den geschwungenen Deckel, der an der Unterseite mit einem Spiegel versehen war (nur zu Schauzwecken – seine Idee), mit dem Stützhalter, um die komplizierte Maschinerie – die Mechanik – des Channon-Flügels besser zur Geltung zu bringen. Dann entfernte er den Tastendeckel und schraubte die Mechanikbacken auf. Er überzeugte sich, dass kein Hammer hochstand und zog dann die gesamte Mechanik auf der Vignolschiene unter der Vorderseite nach vorn. Da das Instrument neu war, ließ sie sich mühelos bewegen. Draußen war bereits ein Passant stehen geblieben und spähte ins Fenster. Das Herausziehen der Mechanik erregte immer Aufsehen. Einen aufgeklappten Flügel hatte jeder schon einmal gesehen, doch durch die Präsentation der Mechanik änderte sich aus irgendeinem Grund die Wahrnehmung. Das Instrument schien nicht länger vertraut. Jetzt waren alle beweglichen Teile jenseits der schwarzen und weißen Tasten zu sehen: die Hämmer, die Wippen, die Stoßzungen, die Hebeglieder, die Dämpfer; das Innenleben war preisgegeben wie bei einer Uhr mit geöffnetem Gehäuse oder einer Lokomotive in einer Reparaturwerkstatt. Geheimnisse – Musik, Takt, Bewegung – wurden auf komplizierte, ausgeklügelte Mechanismen reduziert. Die Menschen waren allenthalben fasziniert davon.
Er öffnete seine Werkzeugrolle aus Leder, nahm den Stimmschlüssel heraus und tat so, als würde er den Flügel stimmen: zog ein paar Saiten hier und da an, prüfte sie und stellte sie neu ein. Alles war tadellos. Dafür hatte er selbst gesorgt, als das Instrument zwei Wochen zuvor nagelneu aus der Fabrik gekommen war. Er stimmte das eingestrichene F eine Spur schärfer als normal und berichtigte es danach wieder, wobei er einige Male kräftig die Taste anschlug. Er hob einen Hammerkopf an und stach vorsichtig mit der dreispitzigen Intoniernadel in den Filz, ehe er den Hammer wieder an seinen Platz zurücksinken ließ. Dieses pantomimische Klavierstimmen sollte Kunden anlocken. Bei einer der seltenen Belegschaftsversammlungen hatte er angeregt, einen versierten Pianisten zu engagieren und im Laden Klavier spielen zu lassen, wie es in den Ausstellungsräumen in Deutschland üblich war; so wie es die Hersteller Pleyel und Érard in den 1830ern in Paris eingeführt und damit große Menschenmengen angelockt hatten. Schwerlich eine bahnbrechende Neuerung also, aber ein spontanes Konzert in einem Schaufenster wäre sicherlich attraktiver als die manierierten Tonwiederholungen auf einem Klavier, das gerade gestimmt wurde. Donk! Ding! Donk! Donk! Donk! Ding! Er hatte sich jedoch nicht durchsetzen können – ein versierter Pianist würde Geld kosten –, und stattdessen wurde ihm die Aufgabe des Schau-Stimmens übertragen: morgens eine Stunde und eine weitere nach dem Mittagessen. Tatsächlich lockte er damit Zuschauer an, wobei er allerdings der einzige direkte Nutznießer war. Er hielt es für unwahrscheinlich, dass das Unternehmen infolge seiner Vorführungen auch nur ein Klavier mehr verkaufte, doch waren schon viele Privatleute und auch Vertreter einiger Institutionen (Schulen, Gemeindesäle, Kneipen) in den Laden gekommen und hatten ihm ihre Visitenkarte in die Hand gedrückt, damit er außerhalb der Arbeitszeit ihr Klavier stimmte. Dadurch hatte er sich mehr als ein paar Pfund hinzuverdient.
Er schlug also einige Male das eingestrichene A an und lauschte dabei mit schräg gelegtem Kopf, wie um den Ton richtig zu erfassen. Dann spielte er ein paar Oktaven. Er stand auf, schob einige Filzstreifen zwischen die Saiten, zückte seinen Stimmschlüssel, setzte ihn wahllos an einen Stimmwirbel an und drehte ihn ein winziges bisschen, um etwas Spannung zu erzeugen, dann lockerte er den Wirbel wieder leicht und schlug den Ton energisch an, um die Saite, deren Schwingungen er durch den Schlüssel hindurch in der Hand spüren konnte, endgültig zu stimmen. Danach setzte er sich wieder, spielte einige Akkorde und lauschte dem ganz eigenen Ton des Channon. Voluminös und mit starkem Nachklang: Der präzis gearbeitete dünne Resonanzboden aus schottischer Fichte unter den Saiten war das besondere Markenzeichen der Firma Channon, ihr Betriebsgeheimnis. Gegen ein Orchester konnte sich ein Channon mindestens so souverän durchsetzen wie ein Steinway oder ein Bösendorfer. Wo genau sich die Fichtenwälder in Schottland befanden, aus denen Channon sein Holz bezog, welche Bäume ausgewählt wurden – je gerader der Wuchs, desto gerader die Maserung – und welche Sägewerke das Holz vorbereiteten, diese Einzelheiten waren nur einer Handvoll Eingeweihter in der Firma bekannt. Channon nahm für sich in Anspruch, dass der ganz eigene, unverwechselbare Klang ihrer Klaviere auf die Qualität des schottischen Holzes zurückging, das sie verwendeten.
Nach dem Ende seiner Scheinvorführung nahm Brodie am Flügel Platz und fing an, den »Skye Boat Song« zu spielen; dabei sah er, dass sich dem einzelnen Zuschauer inzwischen drei weitere hinzugesellt hatten. Er wusste, würde er eine halbe Stunde weiterspielen, würden ihm schließlich zwanzig Leute zusehen. Es war eine gute Idee, die sie auf dem Kontinent gehabt hatten. Von diesen zwanzig würden sich zwei vielleicht erkundigen, was ein Stutzflügel oder ein Klavier kostete. Er unterbrach sein Spiel, nahm sein Plektrum heraus und schlug damit einige Saiten im Flügel an, wobei er aufmerksam lauschte. Wie das wohl auf Außenstehende wirken mochte? Ein Mann, der mit einem Plektrum auf einem Flügel spielte wie auf einer Gitarre. Alles sehr geheimnisvoll –
»Brodie!«
Er sah sich um. Emmeline Grant, Mr Channons Sekretärin, stand seitlich neben der Fensterrahmung und gab ihm mit der Hand Zeichen. Sie war eine kleine, korpulente Frau, die zu verbergen versuchte, wie gern sie ihn hatte.
»Ich bin gerade beschäftigt, Mrs Grant.«
»Mr Channon möchte Sie sehen. Unverzüglich. Kommen Sie mit, jetzt gleich.«
»Ich komme ja schon, ich komme ja schon.«
Er stand auf, überlegte kurz, ob er den Flügel zuklappen sollte, entschied sich jedoch dagegen. In zehn Minuten wäre er wieder zurück. Nach einer Verbeugung vor seinem kleinen Publikum folgte er Mrs Grant durch den Ausstellungsraum mit seinen glänzenden Pianos und in die Haupthalle des Channon-Stammhauses. Auf olivgrün-dunkelgrau gestreifter Tapete hingen strenge, ernst blickende Porträts früherer Generationen von Channons. Ein weiterer Fehler, dachte Brodie: die Halle erinnerte an eine Kunstgalerie in der Provinz oder an ein Bestattungsinstitut.
»Geben Sie mir zwei Minuten, Mrs G. Ich muss mir rasch die Hände waschen.«
»Beeilen Sie sich bitte. Ich warte oben auf Sie. Es ist wichtig.«
Brodie begab sich nach hinten und ging durch eine lederverkleidete, mit Messingknöpfen besetzte Tür in den Lagerbereich, wo sich auch die Werkstatt befand. Ein Mittelding aus Zimmerei und Büro, dachte er jedes Mal, wenn er den Raum betrat, in dem es nach Holzspänen, Leim und Harz roch. Er stieß die Tür auf und traf seine Nummer zwei, Lachlan Hood, bei der Arbeit an; er war dabei, die Saitenstifte in einem Stutzflügel auszuwechseln – ein zeitaufwendiges Unternehmen, denn von diesen Stiften gab es Hunderte.
Lachlan blickte auf, als er eintrat.
»Was ist los, Brodie? Solltest du nicht im Fenster sitzen?«
»Mein Typ wird verlangt. Mr Channon.«
Er öffnete seinen Rollschreibtisch und zog die Schublade auf, in der er seine Tabakbüchse aufbewahrte. »Margarita« hieß die Marke: eine Mischung aus Virginia-, Perique- und türkischem Tabak, hergestellt von einem New Yorker Tabakladen namens Blakely und in Edinburgh nur bei einem Händler erhältlich: Hoskings, am Grassmarket. Er nahm eine der drei Zigaretten heraus, die er bereits vorgedreht hatte, steckte sie an und gönnte sich einen tiefen Zug.
»Was will er denn von dir?«, fragte Lachlan.
»Keine Ahnung. Es sei ›wichtig‹, sagt die liebe Emmeline.«
»Tja, war nett, dich kennenzulernen. Ich nehm mal an, dass ich jetzt deinen Job bekomme.«
Lachlan war aus Dundee und hatte einen starken Akzent. Brodie machte das Zeichen zur Abwehr des bösen Blicks in seine Richtung, drückte nach zwei weiteren Zügen seine Zigarette aus und machte sich auf den Weg zu Ainsley Channons Büro.
Ainsley Channon war der sechste Channon an der Spitze der Firma seit ihrer Gründung Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Auf dem Treppenabsatz stand ein Fünf-Oktaven-Cembalo von 1783 – das erste Channon-Instrument, das ein...