Suche
Lesesoftware
Specials
Info / Kontakt
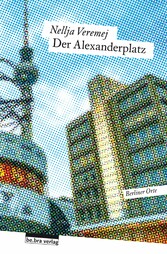
Der Alexanderplatz
von: Nellja Veremej
BeBra Verlag, 2021
ISBN: 9783839301531 , 144 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 8,99 EUR
eBook anfordern 
2
Der Mann mit dem Bauchladen. Wendezeiten
Der Großstadtroman »Berlin Alexanderplatz« spielt in den wirren Goldenen Zwanzigern in Berlins Osten.
Hier die Geschichte in Kürze: Franz Biberkopf, ein kräftiger Arbeiter, verliert seinen Job und schlägt sich als Zuhälter durch. In einem Wutanfall schlägt er Ida (seine Geliebte und »Angestellte«) tot[1] und muss für vier Jahre hinter Gitter. Wir lernen ihn am ersten Tag der Entlassung kennen: »So ist der Zementarbeiter, später Möbeltransportarbeiter Franz Biberkopf, ein grober, ungeschlachter Mann von abstoßendem Äußern, wieder nach Berlin und auf die Straße gekommen, ein Mann an den sich ein hübsches Mädchen aus einer Schlosserfamilie gehängt hatte, die er dann zur Hure machte und zuletzt bei einer Schlägerei tödlich verletzte. Er hat aller Welt und sich geschworen, anständig zu bleiben. Und solange er Geld hatte, blieb er anständig. Dann aber ging ihm das Geld aus, welchen Augenblick er nur erwartet hatte, um einmal allen zu zeigen, was ein Kerl ist.«
Man schreibt Herbst 1927. Zurückgekehrt in sein Revier rund um den Alexanderplatz, beginnt Franz Biberkopf als Straßenhändler zu arbeiten, nebenbei betreibt er wieder Zuhälterei, gerät in den Sog krimineller Machenschaften und geht zu Grunde, wie bald darauf auch die kurzlebige Weimarer Republik.
Der Alexanderplatz von Franz Biberkopf war mit alten und überbevölkerten Wohnblöcken umstellt, die als schmutzig und gefährlich galten. Die anständigen Berliner hielten sich fern von diesen Orten, Franz Biberkopf aber fühlte sich hier wie ein Fisch im Wasser. Mit seinen Augen und Ohren erkundete ich während meiner Lektüre die damalige Linien-, Münz- und Invalidenstraße wie auch viele andere Straßen, deren Namen von der heutigen Stadtkarte wegradiert sind.
Nicht nur seine Umgebung, sondern auch der Platz selbst sah damals anders aus: er war viel kleiner, enger mit Häusern umstellt und stark befahren. Die Alexanderstraße, die ihn im Osten abgrenzte, verlief ungefähr zwischen dem heutigen Galeria Kaufhof und dem Hotel Park Inn[2] und kreuzte sich mitten auf der heutigen Fußgängerzone mit anderen Routen. Das Herzstück des damaligen Platzes war ein Knoten aus Gleisen und Fahrbahnen. Für die Fußgänger, die sich in das laute tobende Verkehrschaos wagten, gab es kleine Bojen: die Berolina-Statue, den Tabakkiosk und das WC-Häuschen.
Die beiden Häuser des Architekten Peter Behrens waren 1928 noch nicht da, an ihrer Stelle beherrschten vier repräsentative Bauten aus der Kaiserzeit den Platz: das Kaufhaus Tietz, das Grandhotel Alexanderplatz, die Georgenkirche und das Polizeipräsidium. Die wichtigsten Achsen des alten Platzes waren die Neue Königsstraße und die Alexanderstraße.
Der damalige Platz lebte im Kraftfeld dieser vier Riesen, die durch ihre Monumentalität und verschnörkelte Architektur stark abstachen, vor allem neben den bescheidenen niedrigen Häusern aus dem 18. Jahrhundert. In einem von ihnen (neben der heutigen Weltzeituhr) mietete das Schnellrestaurant Aschinger Räume (später zog es ins Alexanderhaus an der gleichen Stelle), eine der vielen Filialen der bekannten gastronomischen Kette.
Das populäre Restaurant bot billiges und nahrhaftes Essen in sauberem, solidem Ambiente: Bier, Würste und Erbsensuppe waren beliebt, und dazu gab es Schrippen, so viel wie in eine oder einen hineinpassten: »Wer keinen Bauch hat, kann einen kriegen, wer einen hat, kann ihn beliebig vergrößern.«
Am Alexanderplatz in den zwanziger Jahren: Kaufhaus Tietz (1), Grandhotel (2), Georgenkirche (3), Polizeipräsidium (4) sowie Neue Königstraße (A) und Alexanderstraße (B)
Biberkopf war ein kräftiger dicker Mann, er aß gerne und verabredete sich bei Aschinger mit Freunden und Geliebten – für ihn, der von Stube zu Stube streunte, war die Gaststätte sein Salon, sein Anhaltspunkt. Hier war noch alles beim alten, als Franz aus dem Knast zurückkehrte, aber der Platz selbst war nach vier Jahren seiner Abwesenheit nicht mehr zu erkennen: viele alte Häuser waren verschwunden oder hatten sich in Schuttberge verwandelt, dazwischen lagen abgesperrte Baugruben.
Im zwanzigsten Jahrhundert erlebte jede Generation Berliner eine Großbaustelle auf dem Alexanderplatz, auch Franz Biberkopf musste nun auf Brettern gehen. In diesen Jahren schickte sich der Alex an, ein idealer Weltstadtplatz zu werden. Eine fast dauernd gefüllte Verkehrsschleuse auf mehreren Ebenen wollte er sein, ein Wunder der Moderne, bebaut in Form eines Rondells mit Hochhäusern.[3]
Aber diese Pläne gingen nicht auf, genauso wie die guten Absichten von Franz Biberkopf, mit dessen Augen und Ohren wir den Schauplatz seines grandiosen Scheiterns erkunden.
Gereizt vom Menschengewimmel und eingeschüchtert von tobenden Wagen, kreist Franz durch sein Revier, verblüfft und verloren, als ob er nicht vier, sondern vierzig Jahre weggewesen wäre: In den wirren mageren Zeiten dreht sich die Erde schneller um ihre Achse als sonst.
Er ist viel unterwegs, begegnet vielen Menschen – Invaliden, osteuropäischen Juden, Linken, Hakenkreuz-Armbinden-Trägern, Dieben, Mördern, Prostituierten – sie flüstern, fluchen, schreien und den Takt zu dieser Stimmen-Kakophonie schlagen Baugeräte:
»Rumm rumm wuchtet vor Aschinger auf dem Alex die Dampfmaschine. Sie ist ein Stock hoch, und die Schienen haut sie wie nichts in den Boden.«[4]
Die Wege von Franz Biberkopf über die Baugruben sind schmal, elend und unsicher: Er wandert durch die Lokale, verkauft Schlipshalter, verbreitet auf dem Alexanderplatz erst Zeitschriften für sexuelle Aufklärung, dann völkische Blätter.
Später streift er mit einem Bauchladen voll Schnürsenkel durch die Straßen. Das Geschäft läuft gut, aber durch Betrug geht ihm eines Tages eine ganze Ladung Ware verloren. Er muss untertauchen, verkriecht sich in seiner neuen Stube in der Linienstraße; später beteiligt er sich unwissentlich an einem Diebstahl, verliert seinen rechten Arm und gibt sich geschlagen.
Die Geschichte von Franz Biberkopf zog mich sofort in ihren Bann, ich schlug das Buch auf einer beliebigen Seite auf und konnte nicht aufhören zu lesen: so sehr erinnerte mich der fiebrige Alltag der Berliner zwanziger Jahre an das Leben im Leningrad meiner Jugend.
Als ich 1994 nach Berlin umsiedelte, tauchte ich in den Strom der deutschen Neunziger, und die Perestroika-Jahre lebten in meiner Erinnerung verschwommen und diffus, wie ein grausamer und pittoresker Traum, den ich weder rekonstruieren noch abschütteln konnte. Noch schlimmer war, dass dieser grausame Perestroika-Film für meine Familie und Freunde in Russland nicht aufhören wollte, während mein Leben in der Wende von Tag zu Tag besser wurde. In Berlin wuchsen die zerrissenen U-Bahn-Netze zusammen, die Wunden entlang der abgetragenen Mauer heilten, während Petersburg sich flächendeckend in einen Slum verwandelte. Die deutsche Wende und die sowjetische Perestroika, die allgemein als Synonyme galten, entfalteten sich in meiner Wahrnehmung als entgegengesetzte Begriffe: immer besser versus immer schlimmer.
Das war nicht immer so gewesen – eingangs, in der Phase des Urknalls, herrschen auf der Achse Berlin–Warschau–Moskau Euphorie und Hoffnung auf totalen Frieden und Wohlstand, Perestroika und Wende tanzten Tango und wirkten verliebt und versöhnt. Aber nach einem kurzen Anfall von Harmonie brach der Kontinent wieder entzwei. Der politische Westen wuchs zusammen, stabilisierte sich, wurde kräftiger. Der politische Osten brach auseinander – Teile meiner Verwandtschaft lebten nun im benachbarten Ausland und alles rutsche immer weiter in Chaos und demütigende Armut.
Wie schön, jetzt ist der Sowjetmensch frei, stimmte ich meinen deutschen Freunden zu, teilte aber ihre Begeisterung immer weniger: Kann die Freiheit glücklich machen, wenn dem Sklaven die Fußfessel mit dem Fuß zusammen abgehackt wird?
Ich wollte nicht Spaßverderberin sein oder rückwärtsgewandt wirken und behielt meine Zweifel für mich, aber diese Asymmetrie der Wahrnehmung quälte mich. In dem Roman von Alfred Döblin fand ich einen perfekten deutschen Gesprächspartner, ich las das Buch als Chronik eines untergehenden Staates, Bilder, Empfindungen und Dialoge schienen mir gut vertraut, so sehr ähnelte das Berlin der Goldenen Zwanziger dem Leningrad–Sankt Petersburg meiner Jugend.
Die Krankheitsanamnese war die gleiche: ein rascher Kurswechsel von einer konservativen zu einer liberalen Ordnung, Demütigung nach verlorenem Krieg, eine prekäre wirtschaftliche Lage, Zersplitterung und Umschichtung der Gesellschaft. Für die Armen, die immer mehr und immer ärmer wurden, fühlte sich die verordnete Emanzipierung wie Verwahrlosung an – das alles kannte ich gut, in meiner Jugend war ich von Biberkopfs umgeben.
Wie Franz auf dem zerwühlten Alexanderplatz 1928 balancierten auch wir auf schmalen Brettern über tiefen Gruben, Perestroika heißt übersetzt Umbau.
Wie auch er waren meine Verwandten und Nachbarn zu langsam und zu schwerfällig, um mit der beschleunigten Zeit Schritt zu halten; sie waren zu hart, um die Konturen ihrer Persönlichkeit im Nu neu zu gestalten. Keine Arbeit, eine Tsunami-Welle billiger bunter Waren, launisches und trügerisches Geld. Im Fernsehen tobten Magier, Possenreißer, Baptisten, Kommunisten, Evangelisten, Kapitalisten, Wahrsager, Astrologen, dazwischen drängelten sich dreiste Werbung und gruselige...






